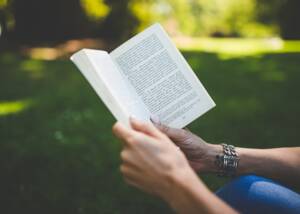Des Teufels Gesangbuch: Kartenspielen zwischen Vergnügen und Verdammnis
News News-Blog
Seit Jahrhunderten erfreut sich das Kartenspiel großer Beliebtheit - doch nicht immer stand die Gesellschaft diesem Zeitvertreib wohlwollend gegenüber. Insbesondere kirchliche Kreise verdammten die bunten Blätter als "Gesangbuch des Teufels". Doch woher stammt dieser Ausdruck und was steckt dahinter?

Die Anfänge des Kartenspiels
Die Ursprünge des Kartenspiels liegen im Dunkeln. Erste Erwähnungen finden sich Ende des 13. Jahrhunderts in Italien. Von dort aus verbreitete sich das Spiel rasch in ganz Europa. Schon früh gab es dabei unterschiedliche Kartentypen und Spielvarianten.
Kartenspiel als moralische Gefahr
Doch mit der Beliebtheit wuchs auch die Kritik. Vor allem die Kirche sah im Kartenspiel eine Gefahr für die Moral. Der Ausdruck "Gesangbuch des Teufels" taucht bereits im 14. Jahrhundert auf. Die bunten Karten galten als Werkzeug des Bösen, das die Menschen vom Glauben ablenkt und zu Müßiggang und Laster verführt.
Auch weltliche Herrscher erließen immer wieder Verbote gegen das Kartenspiel. Sie fürchteten um die öffentliche Ordnung und sahen die Gefahr von Streit, Betrug und finanzieller Not durch übermäßiges Glücksspiel.
Kartenspiel im Wandel der Zeit
Trotz aller Verbote konnte sich das Kartenspiel als beliebter Zeitvertreib halten. Mit der Zeit verlor die Kritik an Schärfe. Ab dem 16. Jahrhundert wurde das Kartenspiel zunehmend als gesellschaftlich akzeptierte Unterhaltung angesehen.
Heute ist das Kartenspiel aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Als Gesellschaftsspiel, aber auch im Profibereich hat es seinen festen Platz. Der einst dämonisierende Begriff "Gesangbuch des Teufels" ist dabei in Vergessenheit geraten - ein Zeugnis vergangener Zeiten, in denen harmlose Unterhaltung noch Anlass zu moralischer Entrüstung bot.